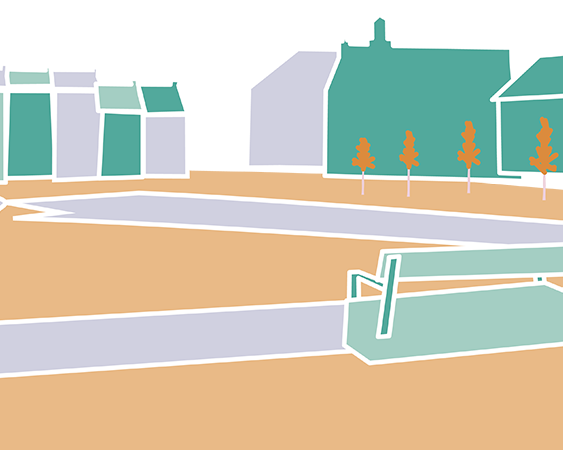Wenn man viele von uns fragen würde, wo für sie der sicherste Ort ist, dann hört man vermutlich oft die Antwort »Zuhause«. Nur wie ist das, wenn gerade die heimischen vier Wände so fremd werden, dass man sich dort nicht mehr sicher fühlt und ein Leben auf der Straße zur besseren Option wird? Genau das ist in Marcus Fall aufgetreten. Mit acht Jahren verließ er sein Elternhaus in Berlin und entschloss sich dazu, auf der Straße zu leben.
Ich war acht, als mein Leben auf der Straße begann. Zuerst blieb ich eine Nacht weg, dann wurden es drei und wenn man schließlich merkt, dass es keinen stört, dass man nicht da ist, dann bleibt man komplett weg. Schon fast ein Gefühl von Freiheit. Die Angst, zu Hause zu sein war wesentlich größer, als die, auf der Straße zu leben.
Aufgewachsen bin ich in Berlin Reinickendorf. Zusammen mit meiner Mutter und meinem Stiefvater lebte ich im zwölften Stock eines 16-stöckigen Hochhauses. Ungefähr 600 Wohnungen fanden dort ihren Platz, die Häuser alle verbunden über einen Haustunnel. Wer mein leiblicher Vater weiß ich nicht, auch nicht bis heute. Mein Stiefvater dagegen war mir gut bekannt. Regelmäßig verprügelte er meine Mutter und mich. Viele Kindheitserinnerungen gibt es nicht mehr, nur dass beide starke Alkoholiker waren und dass es Zuhause einfach schrecklich war.
Meine erste Nacht auf der Straße habe ich seit Jahren mal wieder eine Nacht durchgeschlafen. Ob ich das vorher jemals getan habe? Eine gute Frage. Der Kontakt zu meinen Eltern nahm damit auch zunehmend ab, irgendwann war mein Stiefvater auch nicht mehr da. Weg von meinem ehemaligen Zuhause lernte ich neue Freunde kennen. Kinder, denen es ähnlich ging wie mir und die nun Teil meines neuen Lebens wurden. „Besorg dir mindestens einen Hund!“, war vermutlich der erste Satz, der mir auf der Straße mitgegeben wurde. Nicht nur als Freund und Begleiter, sondern vielmehr zum eigenen Schutz vor sämtliche Art von Überfällen.
In meiner ersten Nacht auf der Straße habe ich seit Jahren mal wieder eine Nacht durchgeschlafen. Ob ich das vorher jemals getan habe? Eine gute Frage. Der Kontakt zu meinen Eltern nahm damit auch zunehmend ab, irgendwann war mein Stiefvater auch nicht mehr da. Weg von meinem ehemaligen Zuhause lernte ich neue Freunde kennen. Kinder, denen es ähnlich ging wie mir und die nun Teil meines neuen Lebens wurden. „Besorg dir mindestens einen Hund!«, war vermutlich der erste Satz, der mir auf der Straße mitgegeben wurde. Nicht nur als Freund und Begleiter, sondern vielmehr zum eigenen Schutz vor sämtlichen Arten von Überfällen.
Mit 10 Jahren lebte ich dauerhaft auf der Straße, wobei die Zeit, die ich dort verbrachte, bereits ab meinem achten Lebensjahr immer weiter anstieg. Wo kann man in einer Millionenstadt wie Berlin die Nacht verbringen? Genau eben in diesen riesigen Häuserblöcken, in welchen genug Leute wohnen, so dass immer irgendjemand die Tür aufmacht. Flure und Treppenhäuser wurden zum neuen Dach über dem Kopf, hier war es nicht nur sicherer, sondern auch warm. Durch den Tag zu kommen und abends mit Leuten einzuschlafen, denen man vertraut, das war das Ziel des Tages. Nach einer gewissen Zeit wurde dieses Leben zur Normalität.
Mit 10 Jahren lebte ich dauerhaft auf der Straße, wobei die Zeit, die ich dort verbrachte, bereits ab meinem achten Lebensjahr immer weiter anstieg. Wo kann man in einer Millionenstadt wie Berlin die Nacht verbringen? Genau eben in diesen riesigen Häuserblöcken, in welchen genug Leute wohnen, so dass immer irgendjemand die Tür aufmacht. Flure und Treppenhäuser wurden zum neuen Dach über dem Kopf, hier war es nicht nur sicherer, sondern auch warm. Durch den Tag zu kommen und abends mit Leuten einzuschlafen, denen man vertraut, das war das Ziel des Tages. Nach einer gewissen Zeit wurde dieses Leben zur Normalität.
Mit acht Jahren lebte ich zwar auf der Straße, war aber laut Gesetz noch schulpflichtig. Dort tauchte ich auch immer weniger auf, bis ich nach ungefähr einem dreiviertel Jahr gar nicht mehr dort anzutreffen war. Ob das keiner gemerkt hat? Doch natürlich hat die Schule das mitbekommen, aber was soll die machen? Vielleicht sagen sie dem Schulamt Bescheid, aber dadurch kommt einen keiner suchen. Mein Leben auf der Straße war nicht schlecht, auch wenn das vielleicht der erste Gedanken ist. Wir hatten unseren Spaß, haben genauso gefeiert, wie andere Leute in unserem Alter und sind das ein oder andere Risiko eingegangen, ob das jetzt U-Bahn surfen oder eine ganze Kiste voller Feuerwerkskörper anzünden war. Nicht jedes Leben ist wie das von Christiane F.
Eines Tages sollte mein Leben eine neue Wendung nehmen. Früh morgens sind sieben, acht meiner Freunde und ich zum Supermarkt gegangen, um von einem LKW die frisch angelieferten Lebensmittel zu stehlen. Aus damaliger Sicht war dieser Moment einer der schlimmsten. Ich befand mich gerade weiter vorne im Inneren des Transporters, als hinter mir die Türen zugeschlagen wurden und ich eingesperrt im Container ohne Ausweg saß. Damals war ich zwischen 14 und 15 Jahre alt. Der LKW-Fahrer, der mich eingesperrt hatte, rief daraufhin die Polizei, die kurze Zeit später vor Ort eintraf. Da ich noch minderjährig war, suchte die Polizei meine Mutter auf und fuhr gemeinsam mit mir zur Wohnung. Diesen Tag werde ich wohl niemals vergessen. Nachdem die Polizisten Sturm geklingelt haben, ohne jegliche Regung zu bekommen, traten sie die Tür ein. Es war halb 9 morgens und meine Mutter lag bereits völlig betrunken auf dem Sofa. Es stand sofort fest, dass ich hier nicht bleiben kann. Man gab mir die Wahl zwischen einem Heim für schwer erziehbare Kinder oder der Teilnahme an einem sozialen Projekt inklusive betreuten Wohnens zur Integration in die Gesellschaft. Meine Wahl fiel auf die zweite Option. Blöd nur, dass dieses Projekt nicht wie ich es mir gewünscht hatte in Berlin stattfand, sondern in Rotenburg Wümme, wovon ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal etwas gehört hatte.
Im Oktober begann die Reise. An einem Mittwoch gegen 19:20 Uhr kam ich in Hemsbünde an. Genau in diesem Moment gingen im ganzen Dorf die Laternen aus und es war stockdunkel. So bin ich also aus der Großstadt in ein Dorf mit 20 bis 30 Häusern gezogen. Die ersten drei Tage habe ich kein Auge zugetan, die Stille war einfach zu laut. Ob diese Zeit für mich oder für die Dorfbewohner schwieriger war, kann ich nun gar nicht mehr sagen. Wie ein schwarzes Schaf fiel ich in der Dorfgemeinschaft auf. Nicht nur unterschied ich mich optisch stark von ihnen, auch war mein Aggressionslevel durch die angestaute Wut sehr hoch. Im Laufe der ersten zwölf Monate habe ich vermutlich die Hälfte der Jugendlichen einmal verprügelt.
Das betreute Wohnen blieb mir nicht erspart. Mein erster Sozialbetreuer, ein Kinderpsychologe, wie man ihn sich nur aus dem Bilderbuch vorstellen kann. »Den mache ich kalt« waren meine ersten Gedanken. Bereits zwei Tage nach meiner Ankunft stand die Polizei vor unserer Tür. Sie berichteten mir, dass meine damalige erste Freundin abgestochen am Bahnhof Zoo gefunden wurde. In dem Moment bin ich innerlich fast gestorben und war wütend, dass ich in dem Moment nicht bei ihr war. Aus heutiger Sicht hat mir meine Situation das Leben gerettet. Wäre ich nicht von dem LKW-Fahrer eingesperrt worden, hätte dieser nicht die Polizei gerufen und wäre ich nicht in das soziale Projekt gesteckt worden, so hätte ich vermutlich neben meiner Freundin gelegen.
Am Montag nach meiner Ankunft, ging es für mich seit langem wieder in die Schule, aufs Rotenburger Ratsgymnasium, eine der wenigen Schulen im Umkreis von Hemsbünde. Dass ich Defizite im Lernstoff hatte, ist nur offensichtlich, vier Jahre war ich gar nicht mehr in der Schule gewesen und die ersten zwei Jahre haben auch nicht viel gebracht. Mein neuer Klassenlehrer stellte mich der Klasse vor. Darauf hörte ich einen Jungen aus der letzten Reihe sagen »Wie sieht der Spinner denn aus?«. Keine zwei Sekunden später hatte dieser eine Platzwunde am Kopf, dank des Stuhles, dem ich ihm quer durch den Klassenraum an den Kopf geworfen hatte. Mein Sozialbetreuer, der gerade mit seinem Auto gewendet hatte, wurde angerufen, um mich wieder abzuholen und mein erster Schultag dauerte keine zwei Minuten.
Eine Woche später der neue Versuch. Stolz auf meine Begrüßungsaktion bin ich nicht, aber dadurch hatte ich in den nächsten Jahren nie wieder ein Problem mit irgendjemanden. Die fehlenden Schuljahre machten sich bemerkbar, lange konnte ich nicht auf dem Ratsgymnasium bleiben und wechselte so ein halbes Jahr später zur Realschule. Durch Freunde und diverse Schummeleien schaffte ich dort sogar meinen erweiterten Realschulabschluss. Mit diesem habe ich es auf die BBS geschafft, um mein Abitur zu machen.
Ein Jahr vor meiner Volljährigkeit und dem damit verbundenen Ende des betreuten Wohnens, gab es einen Betreuerwechsel und ich lernte Micha kennen. Micha war 1.93 cm groß, 130 kg schwer und erinnerte mich an Hulk. Eigentlich war er Busfahrer bei den Berliner Verkehrsbetrieben, die ihren Angestellten eine Freistellung für soziale Projekte anbot. Genau dieser Mann war das Beste was mir passieren konnte. Zum ersten Mal gab es jemanden, der sich mir gegenüberstellte und vor dem ich gewaltig Respekt hatte. Er war kein Sozialarbeiter und musste sich auch nicht an deren Vorgehensweise halten. Mein halbstarkes Ich hatte definitiv Angst vor ihm, beziehungsweise vor dem, wozu er im Stande war. Das war wohl auch der Grund, warum ich jetzt wieder regelmäßig zur Schule ging. Zu schwänzen habe ich mich nur einmal getraut. Auch wenn unsere Wege sich nach einem Jahr wieder trennten, hatte er es während dieser Zeit geschafft, den Grundstein für mein weiteres Leben zu legen.
Durch das soziale Projekt wohnte ich bereits früh allein und nach der Volljährigkeit war auch keine Jugendhilfe mehr da. Keine Einschränkungen und keine Regeln. Ich war auf mich allein gestellt, auch die Miete musste ich selbst zahlen, die während meiner Schulzeit (in welcher ich aufgrund meiner »Extrarunden« bereits volljährig war) schon anfiel. Mit 16 fing ich an, bei Dodenhof zu arbeiten, um genug Geld zusammen zu bekommen, um alles Nötige zu finanzieren. Zum Glück unterstützen mich meine Freunde und Bekannten zu der Zeit sehr viel. Auch meine spätere Ausbildung hätte ich fast abbrechen müssen, da das Ausbildungsgehalt nicht ausreichte.
Während ich in der elften oder zwölften Klasse war, verstarb meine Mutter an Leberzirrhose. Danach hatte ich keine Familie mehr. Mein Vater wollte mich nicht kennenlernen, meinen Stiefvater brauchte ich auch nicht und der Rest der Verwandtschaft war mir unbekannt, aber was man nicht kennt, kann man auch nicht vermissen.
So ätzend alle Probleme und die zusätzlichen drei Jahre in der Schule auch waren, desto dankbarer bin ich ihnen heute. Mein neues Leben zeigte mir, dass ich nie wieder zurück will und dass ich dafür kämpfen muss, mir weiter alles aufzubauen. Dazu trugen auch viele meiner neuen Freunde und Bekannten bei, die an meiner Seite waren und versuchten, mir bestmöglich zu helfen. Von Ehrgeiz und Existenzsicherungsgedanken angetrieben schaffte ich es, neben der Schule auch meine Ausbildung mit 1,6 und mein Studium mit 1,0 abzuschließen. Der Umfeldwechsel, den ich am Anfang so verteufelt habe, war rückblickend das Beste, was passieren konnte, nur so konnte ich aus dem gewohnten Kreis rauskommen und einen neuen Lebensabschnitt starten.
Ich habe viel Glück in meinem Leben gehabt, aber alles was in meinem Leben passiert ist, ist der Grundstein, warum ich heute so geworden bin, wie ich jetzt bin.