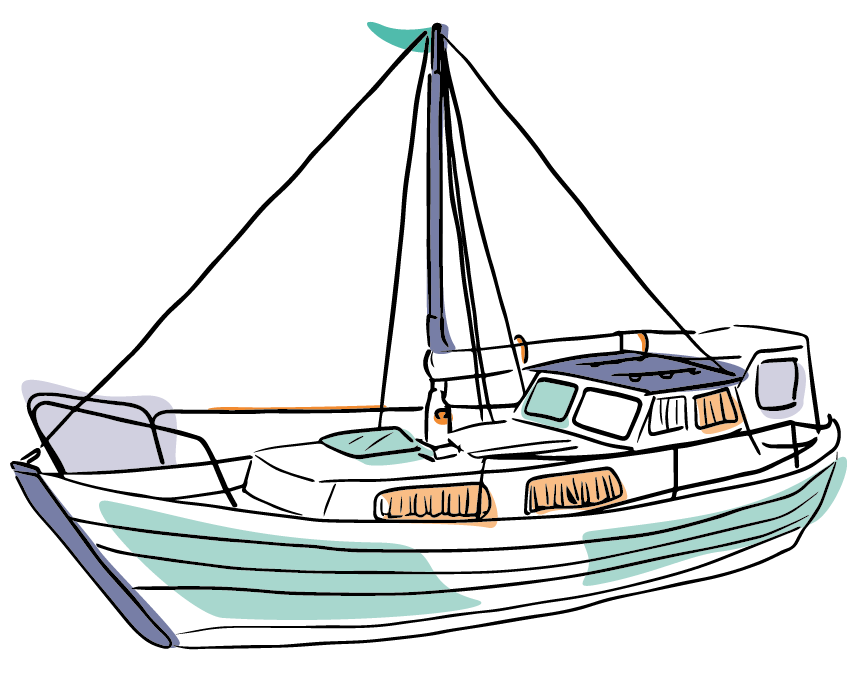Dein Kleiderschrank platzt aus allen Nähten und du weißt trotzdem nicht, was du anziehen sollst? Keine Lust auf Jeans und White-T, aber die alte Lieblingsbluse ist heute irgendwie doch zu bunt? Zeit für etwas Neues! Vor der Pandemie durch Innenstädte schlendern oder Corona-konform das Internet durchforsten – nie zuvor war es so einfach und günstig, seine Garderobe einmal komplett umzugestalten. Im Jahr 2020 hat die Modeindustrie rund 55 Milliarden Euro Umsatz allein in Deutschland gemacht. »Fast Fashion« ist in aller Munde und bei uns an fast jedem dran. Die sozialen Netzwerke pushen uns tagtäglich dazu, zu konsumieren. Was letzten Sommer noch cool war, sieht man plötzlich nicht mehr im Instagramfeed. Die Modebranche lebt von Trends, nur werden diese immer kurzlebiger. Für Oblique habe ich Menschen getroffen, die anders leben und handeln.
Die Autorin Imke Müller-Hellmann ist für ihr Buch »Leute machen Kleider« ihrer Garderobe von Kopf bis Fuß hinterhergereist. Die Reise und ihr Buch lebt von Begegnungen mit den Menschen, die hinter dem stecken, was für uns so selbstverständlich erscheint. Ich habe die Bremerin in einem Zoom Meeting interviewen dürfen:
Welches Bild ist dir bei deiner Reise am ehesten im Kopf geblieben?
Imke Müller-Hellmann Ich habe diverse Reisen gemacht, was an sich schon ohne die Sprachkenntnisse des jeweiligen Landes aufregend war. Dhaka hat mich sowohl im Positivem, als auch im Negativen beeindruckt. Die Stadt war voller Leute, es gibt dort eine hohe Umweltverschmutzung, aber das beschreibe ich ja auch im Buch. China war sehr aufregend, ich habe trotz fehlender Sprachkenntnisse tolle Menschen kennengelernt. Ich bin über Airbnb gereist und muss sagen, dass die Begegnungen mit den Gastgeber*innen mit zu meinen intensivsten Begegnungen zählen. Die Besuche in den Firmen waren relativ kurz, viel intensiver war die Zeit drumherum, die ich bei meinen Gastgebern und Gastgeberinnen erleben durfte. Sie haben mir sowohl sprachlich als auch kulturell oft Dinge genau übersetzen können. Diese Begegnungen habe ich auch zum Teil im Buch mit einfließen lassen: In Hanoi beschreibe ich, wie ich bei Mutter und Tochter übernachte und mit denen die Dinge nochmal nachspreche. Dort ging es um eigene Erlebnisse und Einschätzungen, unter anderem auch um Feminismus in Deutschland vs. Feminismus in Vietnam.
Wirst du wütend, wenn du über »Fast Fashion« nachdenkst?
I. M. H. Ich bin sehr oft wütend, aber nicht auf die einzelne Person. Die einzelnen Menschen machen ja nichts Verbotenes. Ich habe unter anderem Religionswissenschaften studiert und bin der Meinung, dass wir die Probleme dieser Welt nicht über Moral lösen können, wenn die Spielregeln, nach denen wir hier nun mal spielen, andere Verhältnisse einsetzen und ein anderes Verhalten belohnen. Sobald man die Bildungseinrichtungen dieses Landes betritt, werden wir im Konkurrenzdenken erzogen. Und das Ganze geht immer und immer wieder bis hin zum Wirtschaften. Das Wirtschaften ist auf Konkurrenz aufgebaut, es geht darum Märkte zu bedienen und besser zu sein als die Konkurrenz. Wenn ich an das politische System nicht antaste, kann ich den einzelnen nicht verurteilen. Es ist doch viel mehr die Frage, was oder wen das System belohnt. Das heißt, meine Wut bezieht sich eher auf die Spielregeln, nach denen wir hier wirtschaften. Ich möchte, dass wir eine Wirtschaft haben, die den Mensch und die Natur in den Fokus setzt und nicht den Profit.
Das würde natürlich auch bedeuten, dass wir aufhören würden, mit dem Finger immer nur auf andere zu zeigen.
I. M. H. Auf jeden Fall! Es ist zu einfach, dem Kunden selbst die Schuld zu geben. Natürlich finde ich grünes einkaufen klasse. Ich liebe diese »kleinen« Labels, die wirklich aufstehen und sich ansehen, wo das Material, die Baumwolle etc. herkommt und ich finde alle Leute toll, die bewusst einkaufen. Seien es Lebensmittel oder Kleidung, die fair hergestellt ist. Und trotzdem müssen wir auf Dauer an die Spielregeln ran und darüber diskutieren, dass das Profitdenken nicht mehr ausschließlich belohnt wird.
Wie kann ein Einzelner helfen?
I. M. H. Auf kleine und (mittlerweile auch) größere Labels achten, die in der Fair Wear Foundation sind. Aber natürlich ist ein Konsumverhalten, bei dem weniger, aber dafür Hochwertigeres gekauft wird, ratsam. Einfach mal die Arbeit anerkennen, die hinter dem einzelnen Produkt wirklich steckt, im Gegensatz zu schnell und billig zusammengenähten Teilen. Gerade hinter Kleidung, Mode und Textil steckt so viel technisches Know-How, was ich durch mein Buchprojekt auch so näher erfahren habe. Es ist so viel Wissen dahinter, deshalb sollte man es doch auch wertschätzen. Das gilt natürlich nicht nur für die Modebranche. Wie wäre es denn mal darüber nachzudenken, wem ich mein Geld überhaupt geben möchte? Wer bietet mir ein gutes Produkt und wer geht mit meinen Werten einher? Weg vom Mindset des »es kostet mich weniger«.
Wer mehr über Imke Müller-Hellmann und die Erlebnisse ihrer außergewöhnlichen Reise erfahren möchte, kann dies im Buch »Leute machen Kleider« (Osburg Verlag) nachlesen.
Sören Lauer und Felix Halder betreiben mittlerweile drei Ladengeschäfte in Bremen unter dem Namen »fairtragen.« In den Geschäften bieten sie eine große Auswahl an nachhaltiger Mode für Damen, Herren und Kleinkinder. Alle Kleidungsstücke werden unter fairen Arbeitsbedingungen mit ökologischen Materialien hergestellt. Zudem sind viele Produkte vegan und regional produziert. Sören Lauer, 43 Jahre ist gelernter Bankkaufmann und hat sich privat und beruflich immer mehr mit Nachhaltigkeit beschäftigt.
Wie bist du auf das Thema »Fair Fashion« aufmerksam geworden?
Sören Lauer Nachdem ich privat ökologische Ernährung gelernt hatte, stellte ich mir die Frage nach der Kleidung. Da die Haut auch Umweltstoffe aufnimmt, hatte ich nicht so ein gutes Gefühl, stark nach Chemie riechende Kleidung zu kaufen und anzuziehen. Da es damals (2006) noch kein Geschäft für ausschließlich nachhaltige Mode in Bremen gab, haben wir es dann selbst gegründet.
Trägst du selbst mittlerweile nur noch fair produzierte Kleidung?
Sören Lauer Grundsätzlich schon. Bei Wanderschuhen greife ich aufgrund der Qualität und des Komforts (und somit mangels fairer Alternative für mich) noch auf einen konventionellen Hersteller zurück, über dessen Engagement bei den Arbeitsbedingungen ich jedoch informiert bin.
Wo liegt für dich das Problem in der Modebranche?
Sören Lauer Ein Kleidungsstück herzustellen ist ein sehr vielschichtiger Prozess. Durch extreme Rationalisierung und Ausbeutung von Mensch und Boden sind unglaublich billige Kleidungsstücke kaufbar. Die Hersteller werden nicht in die Verantwortung hierfür genommen, sondern verweisen regelmäßig darauf, dass sie Klauseln für ihre Subunternehmer haben, die die Einhaltung von gesetzlichen Regelungen verpflichtet. Die Einhaltung von Mindeststandards für die Beschäftigten ist durch den Preisdruck der Hersteller jedoch nicht gewährleistet.
Was würdest du den Endverbraucher*innen raten?
Sören Lauer Ich finde es wichtig, dass niemand jetzt anfängt, Kleidung wegzuwerfen oder in den Kleidercontainer zu stecken. Denn beides führt nicht zu mehr Nachhaltigkeit. Tauscht am besten Kleidungsstücke mit Freunden oder Bekannten. Organisiert Tauschpartys (soweit pandemiebedingt möglich). Fangt an, eure Kleidung wertzuschätzen und nicht als Verbrauchsprodukt zu sehen, dann kommt der Rest von ganz allein.
Sören Lauer Der zertifizierte ökologische Anbau setzt darauf, dass auch die Arbeitsbedingungen nachhaltig sind. Der faire Handel beinhaltet nicht automatisch, dass ökologische Kriterien zu erfüllen sind, fördert jedoch fast immer die Umstellung auf ökologische Produktion. Beide Kriterien deckt am besten unseres Erachtens das GOTS-Siegel für Kleidung ab. Viele unserer Hersteller nutzen zusätzliche Siegel, die strengere Vorgaben stellen.
Ich möchte gerne andere Leute auf die Problematik aufmerksam machen. Aber wo fange ich an?
Sören Lauer Ich glaube, dass es schwer ist, Menschen zu deiner eigenen Einsicht zu bekehren. Am besten versuchst du, Nachhaltigkeit für dich individuell bestmöglich umzusetzen und gehst in den Dialog mit Freunden und Bekannten.
Pia Steffens und Sören Romboy haben das Sportmode-Label - O‘Ave gegründet. Die beiden stellen Sportbekleidung aus Fischernetzen her. Sie kommen gebürtig aus Norddeutschland und leben nun in Spanien.
Wie seid ihr auf die Thematik rund um »Fair Fashion« aufmerksam geworden?
Sören Romboy Pia hat Mode- und Textilmanagement studiert und dann ihre Abschlussarbeit über Nachhaltigkeitsstrategien in der Luxusmode-Branche geschrieben. Dann war sie auf Sansibar. Da wurde wirklich bergeweise Müll einfach nur verbrannt. Daraufhin waren wir in Thailand unterwegs, auch da war es so, dass am Strand extrem viel Müll angeschwemmt wurde. Uns wurde dadurch eigentlich noch mehr bewusst, was man auf der anderen Seite des Globus sozusagen für einen Impact hat. Weil dort auch extrem viel Müll aus Deutschland oder anderen Ländern einfach lag, der dort angeschwemmt wurde. Und das ist in Indonesien jetzt auch gerade ein Riesenproblem, weil dort die Ströme zusammenfließen, werden diese überhäuft vom Müll, der von der ganzen Welt kommt. Das ist auch der Anreiz den Pia durch ihr Studium und ihre Abschlussarbeit bekommen hat. Wir haben uns dann zusammen hingesetzt und überlegt: »Okay, was wollen wir eigentlich bewirken oder was wollen wir machen in den nächsten 10, 15, 20 Jahren?« So kam dann der Entschluss: »Wir gründen jetzt ein nachhaltiges Sportmode-Label.« Und so ist dann nach und nach die Idee von O‘ave entstanden. Das war quasi die Basis, wo wir dann gefragt haben: »Welche Ressourcen nutzen wir? Welche Prozesse muss man sonst nachhaltig gestalten?« Das heißt, von der Rohstoffgewinnung (was bei uns die Fischernetze sind) über den Prozess der Produktion in Deutschland, bis hin zu einem plastikfreien Versand, den ganzen Prozess komplett CO2-neutral zu machen. Wir wollen zeigen: Sportmode kann komplett nachhaltig sein. Auch wenn man dann eventuell etwas mehr zahlen muss.
Was macht eure Marke nachhaltig?
Sören Ich denke, das habe ich damit schon recht gut erklärt. Also Circle Economy ist die Basis des Ganzen, die Kreislaufwirtschaft, die Kreislauffähigkeit unserer Produkte. Das heißt, dass wir in dem ökonomischen Kreislauf sind. Sprich, wir nehmen etwas, was schon in der Wirtschaft war. Also hier Fischernetze, Teppichreste und Ähnliches und führen es in die Wirtschaft zurück in Form von Sportmode. Oder der zweite Prozess, der Biologische, besteht darin, dass wir eine Ressource nehmen–in diesem Fall die Braunalge – die nachhaltig gepflanzt wird und auch im Nachhinein der Natur wieder zurückgeführt werden kann. Du kannst das T-Shirt also auf den Kompost werfen, ohne dass es der Natur irgendwie schadet. Wenn man nun weiterdenkt, möchte man bei der Produktion CO² ausstoßen. Unser Produkt geht nicht erst einmal um den ganzen Globus: Da kommt die Naht in China an, der Knopf in Taiwan, der Reißverschluss von dort und in der Türkei wird es wieder genäht und ja, das passiert bei uns nicht. Der Weg führt bei uns über Italien und geht dann nach Deutschland, wo es dann komplett konfektioniert wird. In Deutschland ist der Druck groß. Auch das ist nochmal ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, weil wir hier in Deutschland natürlich deutlich strenger reglementiert sind, was Filtersysteme oder Ähnliches angeht. Das ist in anderen Ländern nicht so. Das heißt, da wird es einfach entweder in den Suezkanal oder andere Gewässer geschüttet. Und bei uns wird alles filtriert und aufgearbeitet. Auch da haben wir immer wieder geguckt: Okay, welcher Druckprozess ist der nachhaltigste und der umweltschonendste? Und dann darüber hinaus natürlich das Versandmaterial: Entweder haben wir recyceltes Seidenpapier oder auch unsere Versandbeutel (die sonst meist ja aus Plastik sind) sind bei uns aus Maisstärke. Das heißt, auch die kannst du wieder auf den Kompost werfen. Und unser Versandpartner, also DHL GoGreen, macht CO2-neutralen Versand.
Was ist für euch der Unterschied zwischen nachhaltig und fair oder gehen die beiden Themen ineinander über?
Pia Also für uns geht das definitiv einher. Beim Thema Nachhaltigkeit gib es die drei Dimensionen, sprich: die soziale, die ökologische und die ökonomische Dimension. Sören ist jetzt schon viel auf die ökologische und ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit eingegangen. Und dadurch, dass wir in Deutschland produzieren, haben wir ganz andere Standards. Also in Deutschland gibt es mehr soziale Standards, auf die Wert gelegt wird, sprich, Mindestlohn, etc. Und insofern ist das für uns auf jeden Fall eine der Grundvoraussetzungen für unsere Produktionsstätten und Partner. Wir sehen das so, dass wir eine Art Inspiration sein wollen, auch für andere Unternehmen. Und wenn es der erste Schritt ist, erstmal nur auf die soziale Dimension der Nachhaltigkeit einzugehen, dann ist es für uns auf jeden Fall schon ein Gewinn für die Modebranche.
Sören Man muss leider dazu sagen, dass in der »Fair Fashion« Branche auch nicht alles richtig läuft. Wir waren unter anderem auf der »Munich Fabric Start«, einer der größten Stoff-Modemessen in Europa. Dort war das Hauptthema der Nachhaltigkeit: „Wie lasse ich meinen Konsumenten denken, dass man nachhaltig agiert?“ Also dieser grüne Schleier. Da wird in Portugal oder in der Türkei produziert. Also es wird nicht ganzheitlich gedacht. Dann steht bei vielen vegan oder Ähnliches. Man will dadurch Fair Fashion sein. Es ist also noch sehr viel Marketing, was hinter dem Begriff steckt.
Pia Viele nutzen wirklich einfach diese Begriffe wie »Stoff ist recycelt« oder man nutzt faire Partner. Und wie Sören schon sagt: Wir gehen es ganzheitlich an und wollen inspirieren, damit auch andere Unternehmen das umsetzen können.
Sören Genau, also du musst einen bestimmten Prozentsatz erreichen, ab dem du den Zusatz »Made in Germany« verwenden darfst und dann bezahlst du dafür. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil es wirklich teuer ist, sich diesen Stempel aufzudrücken, obwohl wir komplett Made in Germany sind. Sowas ist für den Konsumenten extrem schwer zu vergleichen, weil diese Transparenz oft nicht gegeben ist. Das Lieferkettengesetz und solche Sachen sind, was das angeht, extrem sinnvoll, würden aber vielen Unternehmen schaden. Wenn man dann mal genau hinsieht, dann sieht man, wo eigentlich wirklich produziert wird. Und ja, es gibt Zertifikate: Blauer Engel oder Ähnliches, die schon mal in die richtige Richtung gehen. Aber auch da: Die Kriterien um das zu erfüllen, sind nicht allzu streng.
Pia Und am Ende bezahlt man eben auch, wie Sören schon gesagt hat, sehr viel Geld. Also wir achten bei der Auswahl unserer Stoffe und unserer Fabrics und beim Sourcing allgemein extrem darauf, dass die Stoffe natürlich zertifiziert sind, wie unser »Seashell Stoff«. Das bringt ganz viele Studien über die Funktionalität mit sich. Und die anderen Stoffe haben ebenfalls die Standardzertifikation. Aber es gäbe noch einen weiteren Schritt: dass wir uns in dem Prozedere auch nochmal zertifizieren lassen. Das kostet für ein Start-up extrem viel Geld und ist eigentlich so gut wie unmöglich. Wenn man mehrere hundert Euro im Monat für so ein Zertifikat bezahlt, dann hat man eine Produktpalette von meinetwegen 20 bis 30 Produkten, das funktioniert einfach nicht.
Sören Aber unser Vorteil ist, dass wir nichts zu verstecken haben, wir können einfach Transparenz bieten. Und das wollen wir auch noch mehr in dem Onlineshop umsetzen. Zum Beispiel beim »Avocadostore« oder auch »PLANETICS.« Ich weiß nicht, ob sie es schon veröffentlicht haben, da siehst du wirklich bei jedem Produkt, wie die Lieferkette ist. Ein bewusst handelnder Konsument muss sich hier Zeit nehmen, um zu recherchieren und nicht nur auf das grüne Marketing achten.
Was prognostiziert ihr für die Zukunft? Denkt ihr, dass sich die Modebranche noch weiter in Richtung Nachhaltigkeit entwickeln wird?
Pia Also meine persönliche Meinung ist, dass die Zugänglichkeit von verschiedenen Materialien (recycelte Stoffe oder Ähnliches) zunehmen wird. Das Problem dahinter ist, dass es in China leichter ist, eine Fabrik neben die eigentliche Fabrik zu bauen, wo das Plastik recycelt wird. Also man baut quasi eine Fabrik, wo Plastikflaschen hergestellt werden. Und die werden automatisch dann recycelt für so einen Stoff. Das ist günstiger als den Müll zu sammeln. Ich denke, dass recycelte Stoffe in Zukunft günstiger produziert werden. Aber dafür muss man als Konsument eben auch ein offenes Auge haben, da dort sehr viel Greenwashing stattfindet.
Sören Das hört sich jetzt alles sehr negativ an. Trotzdem glauben wir, dass das auf jeden Fall mehr wird. Das Bewusstsein in der Gesellschaft dafür wird ja immer größer. Nicht nur im Modebereich, sondern generell in der Nachhaltigkeit; die Leute hinterfragen immer mehr. Und es gibt immer mehr kleine Start-ups, mit Leuten die sich trauen, diesen Schritt zu gehen und einen Impact zu machen.
Pia Oder vielleicht auch da ganz neue Stoffe zu entwickeln, die dann die Branche an sich voranbringen.
Sören Ja, also der Konsument steuert es am Ende. Und die Nachfrage wird immer mehr, das Bewusstsein wird immer mehr. Das heißt, Marken werden auf jeden Fall reagieren müssen, auch die großen. Wenn diese dann reagieren müssen, sind sie gezwungen eine nachhaltigere Alternative zu finden. Und das macht es kleineren Unternehmen vielleicht wieder einfacher, weil mehr in die Entwicklung geht. Im Großen und Ganzen glauben wir definitiv, dass es weiter in die Richtung geht, in dieses bewusste, nachhaltige. Ob es die soziale Komponente ist oder die wirklich nachhaltige, ökologische.
Nach drei Interviews mit interessanten Gesprächen und Interviewpartner*innen konnte ich nun wirklich viel über die nachhaltige Modebranche lernen. Mein Kleiderschrank ist mittlerweile aussortiert und ein paar Teile habe ich schon mit Freundinnen getauscht. Auch wenn es schwerfällt, versuche ich meinen Konsum gering zu halten und mir lieber Teile zu kaufen, die mich und meine Leidenschaft für Mode lange begleiten. Ich hoffe, ich konnte dir als Leser*in einen guten Input geben. Schreib uns gerne auf Instagram, was du zum Thema denkst!
Mehr über OAVE und Sören und Pia kannst du unter
o-ave.com oder unter Instagram
@oave.activewear erfahren.