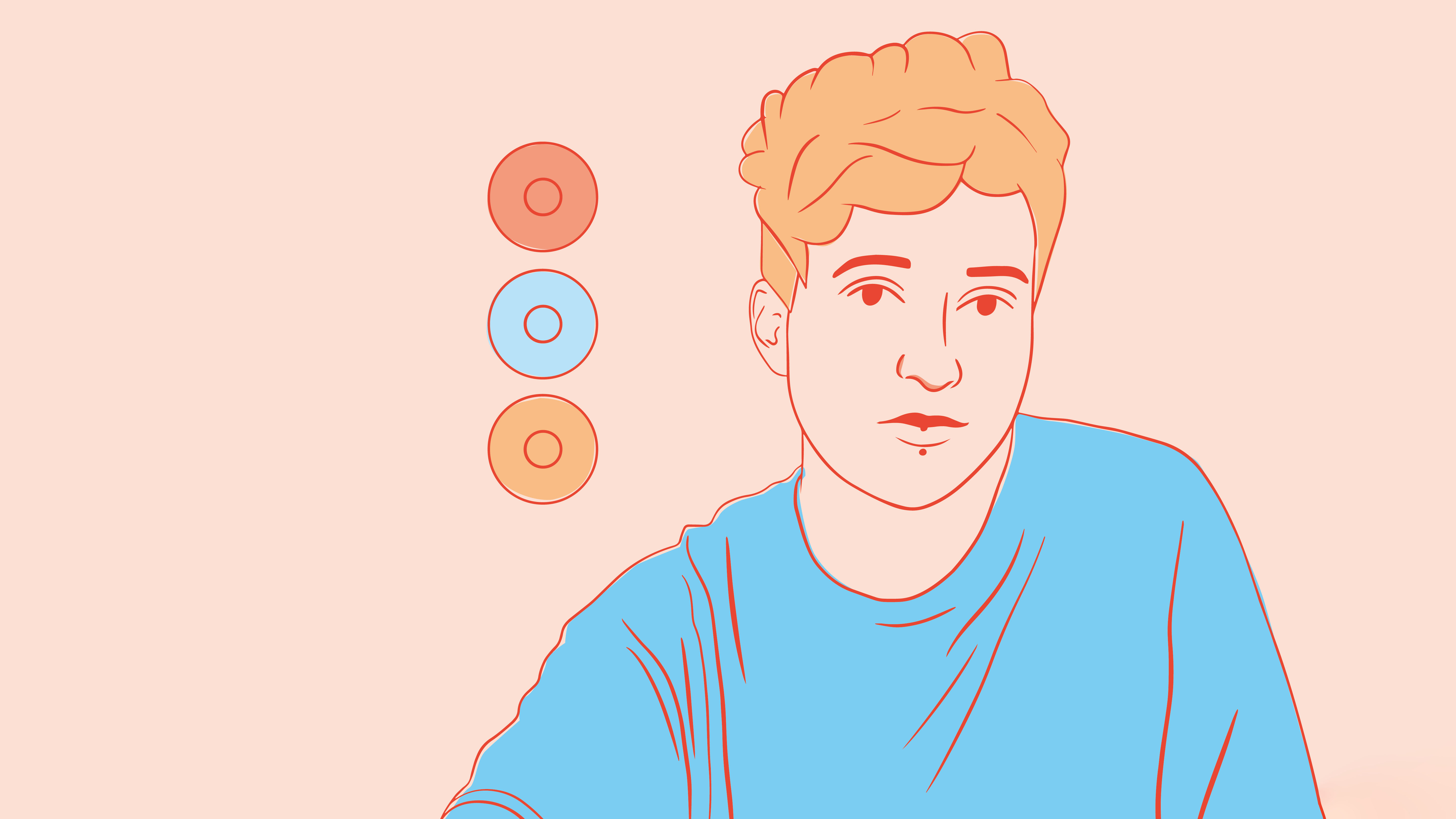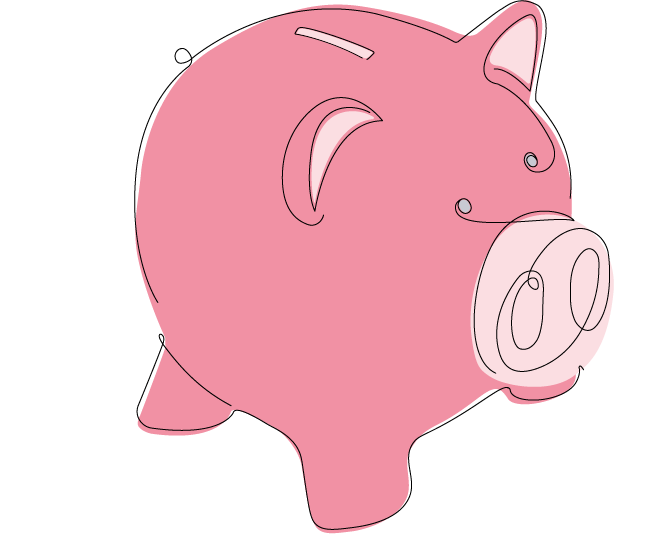Vor gut 2 Jahren landete in meinem Briefkasten ein Schreiben der Hochschule – mein Immatrikulationsschreiben. Ausfüllen, zurückschicken, fertig. Eigentlich ganz einfach. Trotzdem liegt das Schreiben tagelang auf meinem Küchentisch und wartet darauf, losgeschickt zu werden. Denn: ich weiß nicht, was ich eintragen soll. Immerhin ist das eine ziemlich wichtige Sache, da will man ja nichts falsch machen. Meinen Namen kenne ich, meine Adresse auch, alles ziemlich offensichtliche, einfache Angaben. Womit ich hadere, ist der Abschnitt, in dem man sein Geschlecht ankreuzt; männlich oder weiblich. Andere Optionen gibt es nicht. Und das setzt mich unter Druck. Männlich anzukreuzen erscheint mir falsch, das bin ich ja nicht. Bleibt nur weiblich. Oder? Irgendwie auch nicht richtig. Alles in mir wehrt sich dagegen, eine dieser beiden Optionen anzukreuzen. »Ist doch nur eine kleine Angabe, wen interessiert das schon?« Mich interessiert das. Weil diese kleine Angabe einen sehr großen Teil meiner Identität ausmacht. Ich schlafe ein paar Nächte drüber, entscheide mich schließlich, was ich ankreuzen soll, fülle alles aus und bringe die Unterlagen persönlich vorbei.
Als ich die Treppe zum Büro hochlaufe, steigt in mir die Panik hoch. Was, wenn ich einen Fehler gemacht habe in meinen Angaben? Was, wenn das, was ich eingetragen und angekreuzt habe, schlichtweg nicht akzeptiert wird? Ich drücke der netten Dame meinen Umschlag in die Hand, sie öffnet ihn, schaut die Unterlagen durch, alles da, alles gut. »Auf der einen Seite hab ich was dazu geschrieben, ich hoffe, das ist in Ordnung …«. Zu diesem Zeitpunkt bin ich wahrscheinlich hochrot angelaufen und ein wenig zittrig. Sie holt die Seite hervor. Neben männlich und weiblich steht da in meiner Handschrift jetzt »divers«, welches ich angekreuzt habe. »Das ist doch vollkommen okay, so weit ist unser System leider noch nicht, aber das wird demnächst erweitert, dann tragen wir Sie natürlich so ein!« Ich könnte heulen vor Freude. Keine dummen Fragen oder Kommentare, da steht einfach nur mein Name und ein Geschlecht abseits des binären Systems. Und niemand hinterfragt es.
Als ich die Treppe zum Büro hochlaufe, steigt in mir die Panik hoch. Was, wenn ich einen Fehler gemacht habe in meinen Angaben? Was, wenn das, was ich eingetragen und angekreuzt habe, schlichtweg nicht akzeptiert wird? Ich drücke der netten Dame meinen Umschlag in die Hand, sie öffnet ihn, schaut die Unterlagen durch, alles da, alles gut. »Auf der einen Seite hab ich was dazu geschrieben, ich hoffe, das ist in Ordnung …«. Zu diesem Zeitpunkt bin ich wahrscheinlich hochrot angelaufen und ein wenig zittrig. Sie holt die Seite hervor. Neben männlich und weiblich steht da in meiner Handschrift jetzt »divers«, welches ich angekreuzt habe. »Das ist doch vollkommen okay, so weit ist unser System leider noch nicht, aber das wird demnächst erweitert, dann tragen wir Sie natürlich so ein!« Ich könnte heulen vor Freude. Keine dummen Fragen oder Kommentare, da steht einfach nur mein Name und ein Geschlecht abseits des binären Systems. Und niemand hinterfragt es.
transgender / transgeschlechtlich / trans*:
bezeichnet Menschen, welche sich nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugeordnetem Geschlecht identifizieren
cisgender:
beschreibt Menschen, welche sich mit dem ihnen bei der Geburt zugeordneten Geschlecht identifizieren
Ein paar Monate früher hätte ich mich das niemals getraut. Selbst, wenn eine dritte Option vorgegeben wäre, hätte ich mich wohl kaum getraut, mich als solche zu »outen«. Oder einen Namen anzugeben, der nicht der ist, den meine Eltern mir gegeben haben; die Angst und Scham war viel zu groß.
Die Angst, mich bei meinen Mitmenschen als nicht-binär zu outen ist nach wie vor da. Inzwischen habe ich allerdings überwiegend positive Erfahrungen gesammelt und weiß, dass ein Großteil der Menschen in meinem Umfeld mich akzeptiert und hinter mir steht. Auch die Sichtbarkeit und Aufklärung innerhalb unserer Gesellschaft haben sich verbessert, was es deutlich erleichtert, selbst sichtbar zu sein. Inzwischen ist »non-binary« kein ganz so großes Fremdwort mehr, immer wieder mal outen sich auch in prominenten Kreisen Menschen und auch in Filmen, Fernsehshows und Büchern tauchen ab und zu mal Charaktere auf, die ganz offen nicht klar weiblich oder männlich sind.
Als ich anfing, mich mit meiner eigenen Geschlechtsidentität auseinander zu setzen, kannte ich weder persönlich, noch aus den Medien andere Menschen, denen es so ging wie mir. Mit dem Gefühl, komplett allein zu sein mit dem, was in mir vorging, konnte ich schlecht umgehen; es kam mir falsch vor, schließlich ging es ja anscheinend niemandem so – außer mir. Ich versuchte mich also in eine Rolle hineinzupressen und mir zu sagen »ich bin entweder männlich oder weiblich, alles andere macht überhaupt keinen Sinn, wie soll das funktionieren?«. Und trotzdem rutschte ich immer wieder zurück in irgendeinen Bereich dazwischen und lernte langsam, dass Geschlecht eben nicht schwarz oder weiß ist, sondern ein Spektrum, ein ziemlich großes sogar.
In Deutschland gibt es seit Anfang 2019 sogar ein offiziell anerkanntes »drittes Geschlecht« – dies soll zwar nicht den nicht-binären trans Personen unter uns dienen, sondern Intersexuellen, also jenen, die von Geburt an körperliche Geschlechtsmerkmale unterschiedlicher Geschlechter aufweisen. Das ist ein erster großer Schritt in Richtung Akzeptanz und hat dafür gesorgt, dass einem Großteil unserer Gesellschaft endlich mal vor Augen geführt wird, dass Geschlecht mehr ist, als Mann und Frau, wirft aber dennoch die Frage auf: wieso ist dieses Gesetz für intersexuelle Menschen so anders als das, welches für transidente Menschen existiert? Wer in Deutschland seinen Personenstand (das heißt Geschlecht und/oder Namen) ändern lassen möchte und trans ist, muss sich mit dem völlig veralteten so genannten »Transsexuellen-Gesetz« (kurz: TSG) auseinandersetzen. Dieses schreibt zur Personenstandsänderung ein Verfahren vor, bei welchem sich die Antragsteller*innen extrem intimen, persönlichen und unangenehmen Fragen stellen müssen, um zu »beweisen«, dass sie trans sind und es auch bleiben. Diese psychologischen/psychiatrischen Gutachten sind teils sehr menschenunwürdig; wer beantwortet zum Beispiel gern einer völlig fremden Person Fragen zum Masturbationsverhalten und was hat das überhaupt mit der Geschlechtsidentität zu tun? Hinzu kommt, dass das TSG sehr streng ist und häufig gar keine nicht-binären Menschen akzeptiert (seit 2020 muss das TSG auch nicht-binären Menschen ihren Weg ermöglichen, in der Praxis stellen sich jedoch immer noch viele Gutachter*innen und Richter*innen quer). Alle Versuche, neue Gesetze auf den Weg zu bringen und das TSG abzuschaffen oder zu reformieren, sind bisher gescheitert. Ein weiteres Highlight des TSG sind zudem die hohen Kosten, im Schnitt zahlt man ca. 1800€ für eine Personenstandsänderung. Wer ganz viel Pech hat, darf auch mal bis zu 3000€ zahlen und all das nur, weil transgeschlechtliche Personen nicht selbst über ihr Geschlecht entscheiden dürfen und stattdessen andere, fremde Menschen überzeugen müssen, dass ihr Leidensdruck groß genug ist, dass Name und Geschlechtseintrag geändert werden müssen.
Die wenigsten nicht-binären Menschen werden sich über die Frage nach der richtigen Anrede oder Pronomen ärgern, die meisten freuen sich sogar. Für mich ist es häufig auch ein Zeichen, dass ich ernst genommen werde und meine Identität anerkannt wird. Die Alternative ist nämlich meist, dass einfach Pronomen und Anreden verwendet werden, die man »so vermuten würde«, wenn man jemanden sieht. Im besten Fall sind diese dann vielleicht auch richtig, im Zweifelsfall lösen sie bei den Betroffenen Personen aber eben auch sehr negative Gefühle aus. Dazu kommt dann noch, dass es im Deutschen keine wirklich festgelegte geschlechtsneutrale Alternative zu »er« oder »sie« gibt. »Es« klingt herabwürdigend und dann gibt es noch sogenannte Neopronomen wie z.B. »xier« oder »dey«, die ein guter Ansatz sind, bei vielen Menschen aber für noch mehr Verwirrung sorgen. Statt Pronomen kann man in einigen Situationen übrigens auch einfach den Namen benutzen oder einfach versuchen, sie komplett zu umgehen (diese Möglichkeiten sind mir meistens sogar am liebsten, ansonsten habe ich aber auch mit »sie« und »er« keine Probleme).
Die wenigsten nicht-binären Menschen werden sich über die Frage nach der richtigen Anrede oder Pronomen ärgern, die meisten freuen sich sogar. Für mich ist es häufig auch ein Zeichen, dass ich ernst genommen werde und meine Identität anerkannt wird. Die Alternative ist nämlich meist, dass einfach Pronomen und Anreden verwendet werden, die man »so vermuten würde«, wenn man jemanden sieht. Im besten Fall sind diese dann vielleicht auch richtig, im Zweifelsfall lösen sie bei den Betroffenen Personen aber eben auch sehr negative Gefühle aus. Dazu kommt dann noch, dass es im Deutschen keine wirklich festgelegte geschlechtsneutrale Alternative zu »er« oder »sie« gibt. »Es« klingt herabwürdigend und dann gibt es noch sogenannte Neopronomen wie z.B. »xier« oder »dey«, die ein guter Ansatz sind, bei vielen Menschen aber für noch mehr Verwirrung sorgen. Statt Pronomen kann man in einigen Situationen übrigens auch einfach den Namen benutzen oder einfach versuchen, sie komplett zu umgehen (diese Möglichkeiten sind mir meistens sogar am liebsten, ansonsten habe ich aber auch mit »sie« und »er« keine Probleme).
nicht-binär / non-binary:
beschreibt Geschlechtsidentitäten außerhalb des binären Systems von weiblich und männlich
intersexuell / intergeschlechtlich:
bezeichnet Menschen, welche mit sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechtsmerkmalen zur Welt kommen
Wie spreche ich denn nun Personen an, wenn ich gar nicht weiß, welches Geschlecht sie haben, sie gar kein Geschlecht haben oder ihr Geschlecht irgendwo jenseits von dem ist, was ich so kenne? Um das herauszufinden, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit: Fragen! Denn: Vor allem bei nicht-binären Personen gibt es keine einheitliche Anrede, wie wir es bei Männern und Frauen kennen. Geschlechter sind eben vielfältig und sehr individuell und jede*r geht anders damit um.
Die wenigsten nicht-binären Menschen werden sich über die Frage nach der richtigen Anrede oder Pronomen ärgern, die meisten freuen sich sogar. Für mich ist es häufig auch ein Zeichen, dass ich ernst genommen werde und meine Identität anerkannt wird. Die Alternative ist nämlich meist, dass einfach Pronomen und Anreden verwendet werden, die man »so vermuten würde«, wenn man jemanden sieht. Im besten Fall sind diese dann vielleicht auch richtig, im Zweifelsfall lösen sie bei den Betroffenen Personen aber eben auch sehr negative Gefühle aus. Dazu kommt dann noch, dass es im Deutschen keine wirklich festgelegte geschlechtsneutrale Alternative zu »er« oder »sie« gibt. »Es« klingt herabwürdigend und dann gibt es noch sogenannte Neopronomen wie z.B. »xier« oder »dey«, die ein guter Ansatz sind, bei vielen Menschen aber für noch mehr Verwirrung sorgen. Statt Pronomen kann man in einigen Situationen übrigens auch einfach den Namen benutzen oder einfach versuchen, sie komplett zu umgehen (diese Möglichkeiten sind mir meistens sogar am liebsten, ansonsten habe ich aber auch mit »sie« und »er« keine Probleme).
Ein wenig amüsant ist es schon manchmal, zu sehen wie unsicher manche mit der richtigen Ansprache sind. Ab und zu bekomme ich Post, die an »divers [Name, Vorname]« adressiert ist, da dies den Absender*innen ein adäquater Ersatz für Herr/Frau zu sein scheint. Solche Momente sind zwar ganz lustig und irgendwie auch schön, da die Intention selbstverständlich eine Gute ist, aber gleichzeitig sitzt man jedes Mal da und fragt sich, ob tatsächlich niemandem auffällt, dass das irgendwie nicht richtig aussieht und ob man nicht einfach auf das Geschlecht in Anschriften verzichten und stattdessen nur den Namen angeben könnte. Ein ähnliches Problem taucht auf, wenn man einen Brief oder eine E-Mail ganz klassisch mit »sehr geehrte*r …« anfangen möchte, aber gar nicht weiß, ob nun »geehrte« oder »geehrter« richtig ist. Wer da nichts falsch machen möchte, kann natürlich einfach mit »Guten Tag« anfangen, damit geht man allen potentiellen Fettnäpfchen aus dem Weg.
»Warum seid ihr denn immer so fokussiert auf euer Geschlecht?« ist eine von vielen Fragen, die man sich immer wieder anhören darf. Kann ich ja auch irgendwie verstehen. Wer sich nie mit seinem Geschlecht auseinandersetzen musste und im Alltag nie wirklich damit konfrontiert wird, dass Geschlecht irgendeine Rolle spielt, kann sich wohl kaum vorstellen, wie das ist, wenn man ständig über irgendetwas stolpert, was einen dazu zwingt, über seine Geschlechtsidentität nachzudenken. Wenn ich meinen cis Freund*innen die Frage stelle, ob sie sich im Alltag mit ihrem Geschlecht konfrontiert fühlen und in was für Situationen das der Fall ist, wird schnell deutlich: kaum jemand denkt über sein Geschlecht nach und wenn, dann erst in extremeren Situationen; Frauen fühlen sich beispielsweise häufiger von Männern aufgrund ihres Körpers sexualisiert.
Für mich hingegen sind Geschlecht und meine Identität immer präsent. Das liegt meist daran, dass die Welt, wie wir sie gerade erleben, nicht (oder nur in wenigen Fällen) auf ein nicht-binäres Geschlechtersystem ausgelegt ist, aber auch daran, dass es immer wieder Momente gibt, in welchen ich mich aufgrund meines Geschlechts mit etwas so unwohl fühle, dass meine Disphorie sich bemerkbar macht. Dies erleben fast alle transgeschlechtlichen Menschen mal mehr, mal weniger stark, ausgelöst durch das Gefühl, dass etwas »nicht ganz (oder überhaupt gar nicht) passt«. Dies kann sich sowohl auf körperliche Aspekte (wie z.B. die Tatsache, dass man körperliche Merkmale hat, die nicht zur eigenen Geschlechtsidentität passen), oder auf einen sozialen Kontext (zum Beispiel mit falschen Pronomen oder falschem Namen angesprochen werden) beziehen. Geschlechtsdisphorie kann, je nachdem, wie schlimm sich die Situation gerade anfühlt, einfach nur ein etwas unangenehmes Gefühl sein oder bis in eine Panikattacke hinein enden und zu Depressionen und anderen psychischen Problemen führen, weshalb es so wichtig ist, trans* Menschen zu unterstützen, wo es nur geht und ihnen zu ermöglichen, sie selbst zu sein
Geschlechtsdisphorie:
beschreibt das Gefühl der Inkongruenz zwischen dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht und der Geschlechtsidentität
Obwohl ich längst nicht dort bin, wo ich gern wäre, war zumindest der erste Schritt – meinen Namen und meinen Geschlechtseintrag ändern zu lassen – die wohl beste Entscheidung meines Lebens. Zuvor hatte ich angefangen, Situationen zu meiden, in denen ich mich neuen Gesichtern mit meinem alten Namen vorstellen musste, inzwischen sind die etwas unangenehmen Situationen eher die, in denen ich Leuten erklären muss, dass ich jetzt anders heiße und was da noch so alles dazu gehört. Diese Gespräche nehme ich allerdings liebend gern in Kauf, wenn das Resultat ist, dass ich mich nicht länger verstecken oder verstellen muss.
Obwohl ich längst nicht dort bin, wo ich gern wäre, war zumindest der erste Schritt – meinen Namen und meinen Geschlechtseintrag ändern zu lassen – die wohl beste Entscheidung meines Lebens. Zuvor hatte ich angefangen, Situationen zu meiden, in denen ich mich neuen Gesichtern mit meinem alten Namen vorstellen musste, inzwischen sind die etwas unangenehmen Situationen eher die, in denen ich Leuten erklären muss, dass ich jetzt anders heiße und was da noch so alles dazu gehört. Diese Gespräche nehme ich allerdings liebend gern in Kauf, wenn das Resultat ist, dass ich mich nicht länger verstecken oder verstellen muss.
Dieser Artikel basiert auf persönlichen Erfahrungen. Die Erlebnisse jeder transgeschlechtlichen und nicht-binären Person sind individuell unterschiedlich, daher trifft nicht alles aus diesem Bericht auf andere Menschen zu.